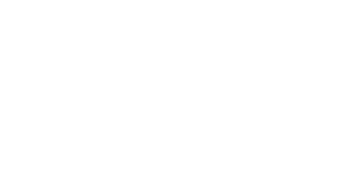Progetto Canzone Italiana
Ti diamo il benvenuto nel sito dedicato all’inestimabile patrimonio sonoro italiano di oltre un secolo di storia, dal 1900 al 2000.
C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
L’autore della musica è Mauro Lusini, mentre Franco Migliacci aveva scritto quel...
Leggi
Una casa in cima al mondo
(Pino Donaggio-Vito Pallavicini) – Pino Donaggio, 1966
Anche quella è ven...
Leggi